Walter Mehring: Der Emigrantenchoral (1934)
Warum Heimat auch in der Wanderschaft liegen muss, und wie Reime dabei helfen, die Ordnung in einer ungeordneten Welt aufrechtzuerhalten
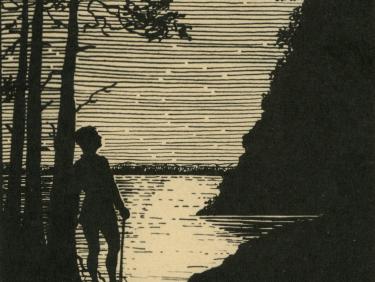
Als der jüdische Satiriker und Dichter Walter Mehring 1933 in die Emigration gezwungen wird, schaut er zunächst eigensinnig zurück über die überquerte Grenze: Und Euch zum Trotz nennt er die Lyriksammlung, die er 1934 in Paris drucken lässt. Euch – das sind die Nationalsozialisten, die den 1896 in Berlin Geborenen schon vor der Machtergreifung drangsalieren. Zu oft fällt Mehring auf, übt schon 1919 im Gedichtband Das politische Cabaret scharfe Kritik an der Obrigkeit, was ihm das erste von vielen Veröffentlichungsverboten einbringt. Er steht mit der Dada-Bewegung in Verbindung, schreibt Chansons für Berliner Bühnen, ist mit Carl von Ossietzky befreundet, der seine polemischen Verse der 1920er-Jahre in seiner Weltbühne druckt. Er wird Bertolt Brecht ebenso wie Kurt Tucholsky prägen, doch den Verboten folgen alsbald die Verbrennungen seiner Bücher. Mehring flieht nach Paris und Wien, er beginnt ein endloses Emigrantendasein. Kurz zuvor, am Vorabend des Reichstagsbrandes 1933, prophezeit er den Deutschen in der Sage vom Großen Krebs den Rückfall in die Barbarei. In Paris kann Mehring immerhin kurz durchatmen. Im Kreise geflohener Freunde, die sich fremd fühlen, dichtet er seinen Emigrantenchoral.
Wanderschaft als Heimat
Die drei Strophen mit Refrainschluss beklagen keinen Heimatverlust, sie prophezeien auch keine neue Heimat. Sie sind ein trotziges Bekenntnis zum Hier und Jetzt, voller Imperative und Mutmachformeln. Die Vergangenheit, jene verlassene Gegenwart jenseits der Grenzen ist voller Unrecht, Verleumdung, Wut und Hass, man soll nach vorn schauen, nicht zurück. Die „Wandrung“ der Emigranten beginnt. Sie haben auf ihrem Weg alles bei sich, sagt der Refrain: „Die ganze Heimat / Und das bißchen Vaterland.“ Jenen, die dort geblieben sind, die nicht mit den Emigranten wandern und sich stattdessen wegducken, ruft Mehring die Aussichtslosigkeit ihres Tuns entgegen: „Was gibt’s da noch zu holn?“
Das klingt nach Widerstand, nach Mutmachgesang. Der Text gilt im Paris der 1930er-Jahre als Hymne der Exilanten, ein mehrstimmiger Choral für viele, kein Einzelschicksal. Mehring benutzt indes eine Sprache, die zugleich zeit- und ortlos erscheint, Jargon mit Avantgarde vermischt: Frühneuhochdeutsch wird besprenzt statt bespritzt und das vormoderne Sacktuch mit den Habseligkeiten eines Wanderers durch die Welt getragen; die Berliner Schnauze der 1920er kennt uzen als foppen bzw. necken, und die Waterkant entstammt ebenso der (hier nordischen) Dialekt- bzw. Umgangssprache wie das Verschleifen der Endungen in holn, gestohln, Poln usw. Die Reime bilden dabei den Zusammenhalt von vermeintlich Gegensätzlichem – so reimt sich mit Vaterland auf Emigrant ausgerechnet das besonders gut, worauf es Mehring ankommt: Der Wanderer trägt die Heimat mit sich, er lässt sie nicht zurück. Der Text ist in seiner Originalgestalt mit seinen vielen Zeilenumbrüchen so bildsprachlich verschlungen wie der Weg des Emigranten. Dass er als Gedicht funktioniert, verdankt er dem deutschsprachigen Paarreim. Dieser ist – und bleibt lebenslang für Mehring – der Orientierungspunkt, er erzeugt Zusammenhalt und Verbundenheit in einer ungeordneten Welt. Wichtig auch: Der Emigrant ist nicht der Heimat- und Vaterlandslose, zu dem er durch die Vertreibung degradiert werden soll. Er ist auf der Suche – „Und wo ein Blick grüßt, werft die Anker aus!“ –, kann aber jederzeit weiterziehen, bis der Weg endet, das Lebensvisum abläuft. Erst mit dem Tod verliert der Mensch seine Heimat.
Man muss dieses trotzige Projekt einer Individual-Heimat nicht mit dem von den Nationalsozialisten missbrauchten Narrativ des wandernden, heimatlosen Juden gleichsetzen, um zu erkennen, dass auch in Mehrings Gedicht Zwang und Unrecht überhaupt erst die Auslöser für die Wanderschaft sind. Diese Vergangenheit soll zwar vergessen werden, so verlangt das Gedicht, doch es erinnert zugleich wortstark daran. Entsprechend ist ebenso konsequent wie bedrückend, dass der Wandernde – wie der Refrain dreimal betont – nirgendwo ankommt.
Keine Heimkehr mehr
1939 erträgt Mehring eine sechsmonatige Internierung in Frankreich als feindlicher Staatenloser, nach der Freilassung 1940 wird er bereits von der Gestapo gejagt, 1941 gelingt ihm in letzter Minute die Flucht vor den Besatzern aus Marseille – mit Zwischenstopp auf der Tropeninsel Martinique – nach Miami, es geht weiter nach Hollywood, 1942 schließlich nach New York. Seine Gedichte ändern kaum den Ton, die Sammlung No road back – kein Weg zurück von 1944 spricht mit ihrem Titel für sich.
Erst in den 1950er-Jahren kehrt Mehring nach Europa zurück, nicht nach Deutschland, sondern in die Schweiz. Er publiziert wenig, lebt zurückgezogen und stirbt 1981 in Zürich. Er ist nie zuhause angekommen. Friedrich Dürrenmatt bringt dies am 18. Mai 1956 in der Weltwoche auf den Punkt: „Die Menschen wollen ihre Untergänge entweder besungen haben oder vergessen. […] Odysseus hat entweder heimzukommen oder umzukommen, beides ist für den Ruhm gleich dankbar, gleich verwendbar, Mehring ist nur davongekommen. Damit läßt er es bewenden. Sein Ithaka ist untergegangen. Es gibt keine Heimkehr mehr.“
Heidelberg, im Januar 2025
Christiane Wiesenfeldt, TP A05
